MVP als Digitalisierungs-Booster – Warum 60 Tage mehr als genug Zeit sind
Um ein neues Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, nutzen viele Unternehmen den schrittweisen, linearen Weg: die Wasserfallmethode. Ein Produkt ist demnach erst dann marktreif, wenn es fertig ist und über alle Funktionen verfügt, die der Endkunde benötigt. Aber stimmt das auch? Die erste minimal funktionsfähige Version eines Produkts bezeichnet man als Minimum Viable Product (MVP). Man entwickelt diese, um mit geringstmöglichem Aufwand den Kunden-, Markt- und Funktionsbedarf zu decken. Woher wissen Unternehmen aber, welcher das ist?

Die Entwicklung minimal funktionsfähiger Produkte stützt sich auf das Prinzip agilen Arbeitens: So lassen sich mit geringem Aufwand große Erfolge erzielen!
Bei MVPs ist praktisch der Weg das Ziel. Man veröffentlicht minimal funktionsfähige Produkte, um unter realen Bedingungen zu testen, wie potentielle Kunden sie bewerten. Dass diese Produkte mit minimalen Anforderungen und Eigenschaften ausgestattet werden, verringert neben dem Arbeitsaufwand, den Kosten und der beanspruchten Zeit auch das Risiko, dass ausgereifte Produkte nicht gekauft werden, weil sie schlicht und ergreifend niemand benötigt. Durch den Launch eines „Prototypen“ versuchen Unternehmen herauszufinden, welche die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe sind. Im nächsten Schritt verbessern und entwickeln sie die Produkte durch das gesammelte Feedback in eine entsprechende Richtung weiter.
Der MVP-Prozess stützt sich auf zum Teil unkonventionelle Grundprinzipien, die die schnelle Implementierung und Validierung von Ideen befürworten. Stark regulierten Unternehmen kann es da schwer fallen, sich von altbewährten Prozessen zu lösen, die für die Umsetzung neuer Ideen viel Zeit und Sorgfalt vorsehen. Diese Methoden sind meist tief in die Unternehmenskultur eingebettet. Das Prinzip des MVPs kann solch festgefügte Denkprozesse aber lösen und dafür sorgen, dass Unternehmen agiler arbeiten.

Die Devise lautet „think small“ statt „think big”
Am Anfang des MVP-Prozesses steht eine Hypothese, die man bestätigen oder widerlegen will. Basierend auf dieser Hypothese realisiert man ein MVP mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand. Dieses soll die Lösung für ein identifiziertes Problem bieten. Gleichzeitig soll der Prototyp frühestmöglich für Anwender bereitstehen, damit diese ihn testen und bewerten. Anhand des Feedbacks werden weitere Anpassungen vorgenommen und Maßnahmen zur Verbesserung des Produkts ergriffen. Diese Schritte sind wiederholbar. Das Stichwort ist Skalierbarkeit: Irgendwann muss das Produkt so gut sein, dass Kunden bereitwillig dafür zahlen.
Wie gering ist aber der geringstmögliche Entwicklungsaufwand? Mit anderen Worten: Wie „minimal“ darf ein Produkt sein, damit es (relativ) risikofrei veröffentlicht werden kann? Das MVP ist ein bereits in der Entwicklungsphase gereiftes Konzept, welches nicht nur bei bestehenden Kunden einen „Wow“-Effekt hervorrufen soll, sondern eben auch bei neuen Nutzern. Daher müssen Unternehmen sich fragen, wann ein Produkt einen Reifegrad erreicht hat, der Nutzern schon während der Testphase ein „Wow!“ entlockt und es dann auf den Markt bringen. Schnell vorzugehen statt perfektionistisch – und für die Entwicklungsphase beispielsweise nur 60 Tage vorzusehen – hat zum einen den Vorteil, dass man möglichst wenige Ressourcen verbraucht, um einen Erfolg zu erzielen. Zum anderen, dass man im Falle eines Misserfolgs langfristig auf einen Erfolg hinarbeitet. Ist das MVP in der ersten Testphase nicht gut angekommen, wird es in einer zweiten oder dritten Phase durch die vorgenommenen Anpassungen besser abschneiden.
Agiles Arbeiten
Agilität ist der Schlüsselbegriff. Es wird immer nur der nächste Schritt konkret geplant, statt nach der Wasserfallmethode vorzugehen. Letztlich misst man der Erfolg des Produkts nicht nur am Umsatz, sondern auch an den Kosteneinsparungen.
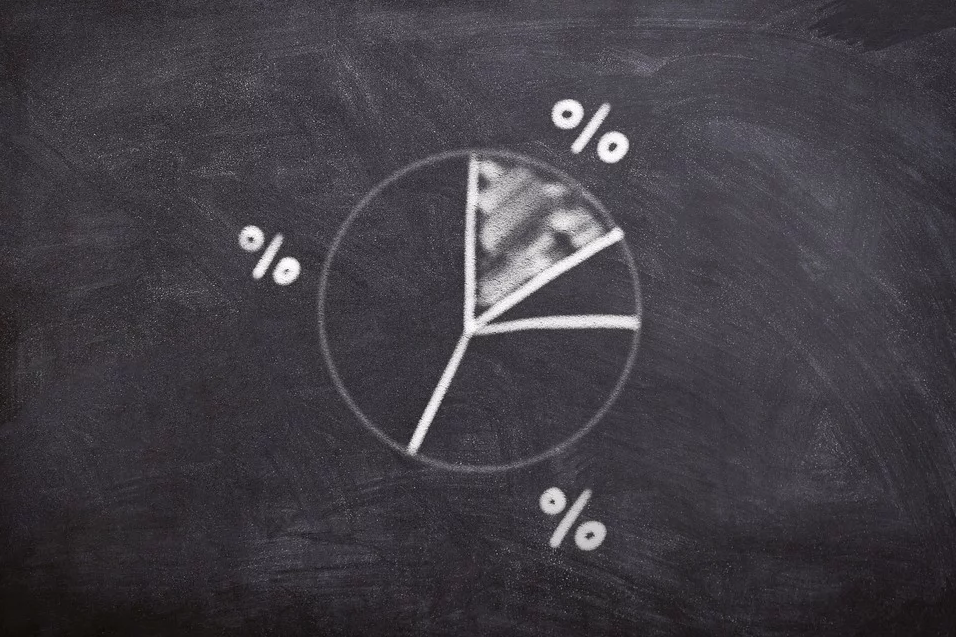
Ein MVP zu entwickeln bedeutet also nicht nur, dessen Funktionsumfang zu minimieren, sondern auch das (finanzielle) Risiko, mit dem es auf dem Markt erscheint. Ein Risiko könnte sein, dass ein Produkt vorbei am Markt und somit vorbei an Kundenbedürfnissen entwickelt wird und sich nicht verkauft. Mit einem frühen Markteintritt evaluiert man, ob eine Produktidee überhaupt Chancen am Markt hat. Probiert man mehrere Ideen aus, identifiziert man die besten frühzeitig und konzentriert sich auf diese.
Insbesondere für Start-ups, denen zu Beginn ohnehin wenig Mittel zur Verfügung stehen, kann das ein entscheidender Vorteil sein. Aber auch etablierte Unternehmen sehen es nicht gerne, wenn sie in neue Produkte investieren, die keiner haben möchte.
MVPs treiben die Digitalisierung voran
Minimum Viable Products sind eine schnelle, kostengünstige und flexible Alternative zu klassischen Herangehensweisen, um Innovation und digitalen Fortschritt in Unternehmen voranzutreiben. Beispielsweise kann die Umstellung eines händischen Prozesses auf den digitalen Weg die Effizienz steigern und Kosten senken. Zu diesem Zweck erkennen Unternehmen bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase, ob sie die richtige Richtung einschlagen – oder andernfalls rechtzeitig ihren Kurs korrigieren. MVPs können Unternehmen die Digitalisierung sämtlicher Prozesse erleichtern. Hierzu bedarf es nicht nur des Vertrauens seitens des CEOs, sondern auch der Mitarbeiter, denn insbesondere bei einem sehr vagen langfristigen Ziel muss davon ausgegangen werden, dass das Entwicklerteam unterwegs die richtigen Entscheidungen trifft, ohne vorher zu wissen, wie es dorthin gelangt. Das MVP-Prinzip scheint zunächst wenig intuitiv und eher risikofreudig zu sein, doch lässt man sich auf den agilen Entwicklungsprozess ein, wird man merken, dass sich langfristig auf den Erfolg – und auf ein Produkt, das auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist – hinarbeiten lässt.

